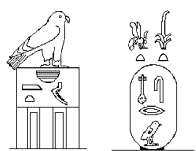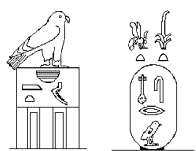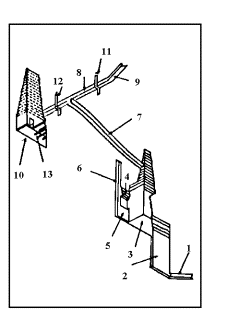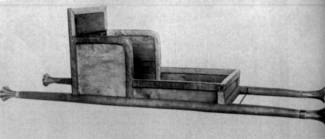|
Vater: Huni
Mutter: Meres-anch I
Geschwister: -
Ehefrau: Hetep-heres I
Söhne: Rahotep, Nefer-Maat, Chufu
Töchter:
Merit-Ites, Neferet-kau, Hetep-heres II |
Snofru gilt als Sohn des
Huni mit einer Nebenfrau (Meresanch I). Durch Heirat mit seiner Halbschwester
Hetep-Heres I wurde er zum Begründer der 4. Dynastie. Er war der
Vater der Merit-Ites und des Cheops. In
jüngster Zeit wurde eine Markierung
aus dem 24. "Jahr der Zählung" gefunden. Diese Zählung
(Steuererhebung) fand im
Alten Reich alle zwei Jahre statt. So könnte er möglicherweise 48 Jahre
regiert haben, wenn man zu seiner Zeit die Zählung nicht bereits jährlich oder
nach Bedarf vorgenommen hat. So ist die Dauer von Snofru´s Regentschaft
umstritten.
Belegt sind Feldzüge gegen Nubien, wo er
lt. Palermostein 7000 Gefangene macht und 200.000 Stück Vieh erbeutet. Eine
Felsinschrift aus Chor el-Aqiba berichtet von 17.000 Gefangenen, die der mit
20.000 Soldaten durchgeführte Feldzug erbracht hat, um "Unternubien zu
zerhacken". Ein weiterer Zug nach Libyen
zur Sicherung der Reichsgrenzen bringt 1.100 Gefangene und 13.000 Stück Vieh.
Auch den Sinai scheint er dauerhaft für Ägypten gesichert zu haben.
Unter Snofru erlebte der Bau der Grabstätten eine
gravierende Änderung: es wurde eine Aufteilung in die Komponenten Taltempel - Aufweg - Kultstätte - Pyramide eingeführt.
Die Pyramide von Meidum wird ihm zugeschrieben, möglicherweise wurde sie jedoch von
seinem Vater Huni begonnen und er hat sie nur vollendet.
Informationen über diese Pyramide finden Sie unter Huni.
Die Knickpyramide
Ganz sicher baute Snofru die Knickpyramide
von Dahschur. Diese
Pyramide ist das erste Bauwerk, das von Grund auf als echte Pyramide geplant
wurde.
Das
Bauwerk mit dem antiken Namen ''Snofru erglänzt'' wurde im 15. Jahr der
Regierungszeit des Königs begonnen. Der Standort ist ein bis dahin unbenutztes
Wüstenplateau, dessen Untergrund aus relativ weichen Tonschieferplatten
besteht. Geplant war eine Pyramide mit einem Neigungswinkel von 60° und 'nach
innen' gelegten Steinlagen. Dieser Konstruktionsmangel und der instabile Boden
zwangen den Baumeister, bereits früh einen Steingürtel um das Bauwerk zu legen
und den Winkel auf 54° 27' 44" zu verringern. Auch diese Maßnahme reichte
nicht aus. Der Druck der riesigen Steinmassen war bereits so hoch, dass man bei
einer Höhe von 45 m eine weitere Winkelveränderung auf 43° 22' vornehmen
musste. Zur Druckentlastung verlegte man die Steinlagen jetzt horizontal. Bei
einer Basislänge von 188 m war so eine Pyramide mit einem geknickten Böschungswinkel
entstanden, die immerhin noch 105 m hoch war.
Die Pyramide war aus örtlichem Kalkstein erbaut; Lücken
zwischen den Steinen waren mit Geröll und Schutt verfüllt. Die Verwendung von
Gipsmörtel hatte gerade erst begonnen. Vielleicht waren all dies Gründe für
Snofru, mit dem Bau einer dritten Pyramide zu beginnen: der "Rote Pyramide".


Dahschur, Knickpyramide des Snofru
(04-01-02, 09) Fotos: Anke Klein
|

Knickpyramide, N-Eingang (04-01-05)
Foto: Anke Klein
|

Knickpyramide,
Verkleidung (01-04-06) Foto: Anke Klein
|

Dahschur,
Knickpyramide des Snofru (04-01-03)
|
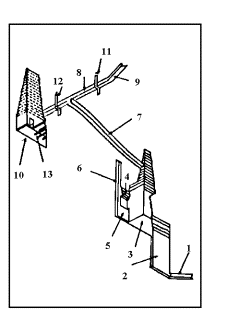
|
Der nördliche Eingangsstollen führt in einen horizontalen Gang (1) und zu einem hohen, engen Vorraum (2). Dieser ist direkt mit der
unteren Grabkammer (3) verbunden. Zwei Durchgänge (4, 5) münden in einen senkrechten Blindschacht (6). Der obere Teil der
unteren Kammer steht durch einen Gang (7) mit einem horizontalen Quergang (8) in Verbindung. Dieser Gang kommt vom westlichen
Pyramideneingangsstollen (9) und führt zur oberen Kammer (10). Zwei Fallsteine (11, 12) haben ihn versperrt. Die obere Kammer ist
unvollendet und enthält noch eine Anzahl horizontaler Balken aus Zedernholz (13).
Schnitt durch die Kammern
(04-01-04)
|
|

Knickpyramide, N-Zugang
(04-01-07)
Foto: Anke Klein
|

Knickpyramide,
Kapelle (01-04-08) Foto: Anke Klein
|
Die Innenbauten der Knickpyramide sind insofern
einmalig, weil hier zwei Zugänge zu zwei separaten Grabkammern angelegt wurden,
die miteinander durch einen Gang verbunden sind. Ein Eingang liegt in der Mitte
der Nordseite, etwa 12 m über Bodenniveau. Eine steile, 74 m lange Passage führt
abwärts zu einer Vorkammer, die bereits unterirdisch ist. Die Decke der
Vorkammer wird durch ein Kragsteingewölbe aus mächtigen Kalksteinblöcken
gebildet.
Über eine steile und schmale Treppe erreicht man die
eigentliche ''untere'' Grabkammer. Auch diese besitzt eine Decke aus Kragsteinen
und ist dadurch 17 m hoch bei einer Grundfläche von 5 m x 6,3 m. Eine kurze
Passage mündet in einen vertikalen Schacht, der genau auf der Pyramidenachse
liegt.
In 33 m Höhe auf der Westseite liegt der zweite
Eingang. Eine 65 m lange Passage führt abwärts. Auf dem letzten Teilstück vor
der ''oberen'' Grabkammer ist dieser mit zwei Fallsperren versehen, die nie
geschlossen wurden. Diese Grabkammer misst 8 m x 5,3 m und ist durch das Kraggewölbe
16,5 m hoch. Reste von Zedernbalken zeigen, dass man bereits in der Bauphase
Probleme mit der Statik hatte.
Beide Grabkammern sind
durch einen grob gehauenen Tunnel verbunden, der zwischen den Sperren vor der
''oberen'' Kammer begann und hoch im Kragsteingewölbe der ''unteren'' Kammer
endete.
Vor der Ostseite der Knickpyramide befand sich eine
kleine Kapelle mit zwei 9 m hohen Kalksteinmonolithen mit den Namen des Königs.
Der Rest einer dieser Stelen befindet sich heute im Garten des ägyptischen
Museums in Kairo. Die gesamte Pyramide ist von einer Kalksteinmauer umschlossen,
die auch eine kleinere Nebenpyramide umschloss. Dieses Bauwerk war bei einer
Basislänge von 53 m etwa 32 m hoch und besaß ebenfalls eine ausgebaute
Grabkammer, eine Opferstätte sowie zwei Stelen.
Die Nebenpyramide wurde früher für das Grab der Königin
Hetepheres I. gehalten (Ricke), die heutige Pyramidenforschung erkennt in
diesem Bau eine Kultpyramide (Rainer Stadelmann), zumal der gesamte Bezirk der
Knickpyramide als Stätte für den Königskult umfunktioniert wurde und es keine
Hinweise auf eine Bestattung gibt.
Ein über 700 m langer Aufweg führt vom
Pyramidenbezirk zum Taltempel. Der Aufweg war mit Wänden aus Kalkstein
eingefasst. Der Taltempel selbst ist ein kleiner Rechteckbau. Auf der Rückwand
befanden sich sechs Statuen des Königs, davor 2 x 5 rechteckige Säulen. Die Wände
des Hofes waren mit Reliefs verziert, mit Darstellungen der Landgüter des Königs,
die ihm opfern. Es ist mittlerweile belegt, dass hier der Kult für und um König
Snofru noch im Mittleres Reich vollzogen wurde.
Der Pyramidenkomplex wurde
erstmals durch Perring im September 1839 untersucht. Weitere Untersuchungen
fanden unter Fachri statt und die jüngste Dokumentation erfolgte durch das
DAIK (Deutsche archäologische Institut Kairo) unter Stadelmann
um 1980.
Um die Nebenpyramide rankt sich eine
schöne Geschichte:
Nach
Reisner wurde Hetep-heres in dieser Pyramide bestattet,
jedoch hätten Grabräuber bereits kurz nach der Beisetzung die Pyramide
aufgebrochen und die Mumie wegen der kostbaren Ausstattung vermutlich gestohlen.
Ihr Sohn Cheops wurde wohl von dem
Grabfrevel informiert, jedoch hat man ihm das Verschwinden der Mumie
verschwiegen. Cheops gab daraufhin
den Befehl, für seine Mutter vor seiner im Bau befindlichen Pyramide ein 32 m
tiefes Schachtgrab anzulegen. In aller Eile erfolgte die Umbettung. 1925 fand
man dort alle Grabbeigaben, den Sarkophag und die Kanopenkrüge, jedoch nicht
die Mumie.
Diese Theorie wird allerdings heute von einigen Ägyptologen
angezweifelt (Stadelmann).
Die Rote Pyramide
Die "Rote Pyramide" von Dahschur wird ebenfalls Snofru zugeschrieben. Sie
misst 220 m x 220 m im Quadrat und war bei einem Winkel von 43° 22´ etwa 105 m hoch.
Diese Pyramide gilt als die erste "richtige" Pyramide. Snofru hat mit dem Bau der Pyramide im 15. Jahr der Zählung begonnen,
also möglicherweise sein 30. Regierungsjahr. Die Pyramide wurde sehr sauber
konstruiert und gebaut. Im Schutt fand Stadelmann, der zehn Jahre hier
grub, das zerstörte Pyramidion (die Pyramidenspitze).


Rote Pyramide des Snofru
(04-01-10) Foto: Anke Klein Schnitt
(04-01-11)
Die Substruktur der Pyramide
ist einfach. Der Eingang befindet sich in der Mitte der Nordseite, auf 28 m Höhe.
Von dort führt ein fast 63 m langer absteigender Gang bis auf Bodenniveau. Hier schließen sich zwei Vorkammern an. Im
oberen Teil der 2. Kammer befindet sich der Zugang zur eigentlichen Grabkammer,
die bei einer Breite von 4,18 m 8,55 m lang ist. Die Decke aller drei Kammern besteht
aus einem Kraggewölbe, das in der Grabkammer eine Höhe von 14,67 m erreicht.
Eine gleiche Konstruktion hat den auch die "Große Galerie" der
späteren Cheops-Pyramide.
|

absteigende
Passage in der Pyramide
(04-01-12) Fotos: Anke Klein
|

Kragsteingewölbe
in der Pyramide (04-01-13)
|
Unter dem Fußboden der Grabkammer wurden menschliche Überreste gefunden; ob
diese von Snofru stammen, ist nicht geklärt.
|

Pyramidion
der Pyramide (04-01-15) Foto: Anke Klein
|

Totentempel der Pyramide
(04-01-14) Foto: Anke Klein
|
Der östlich der Pyramide vorgelagerte
kleine Totentempel wurde erst vor wenigen Jahren von Stadelmann
ausgegraben. Außer den Fundamenten gab es nur wenige brauchbare Spuren, und
auch vom Aufweg wurden nur Reste gefunden. Die wichtigste Entdeckung stammt aus
der Zeit des Pepi I., der per Erlass die Tempelpriester der zwei
Totenstädte des Snofru von der Steuer befreit hat.
Hetep-heres I.
Wie bereits oben erwähnt überlebte die
Königin ihren Ehemann und starb wohl zur Zeit der Errichtung der
Cheops-Pyramide, wo ihr Sohn sie bestatten ließ.
Die Gegenstände aus dem Schachtgrab
der Hetep-Heres I. wurden restauriert und zeugen heute noch vom
handwerklichen Geschick und der hohen Kultur zur Zeit des Alten Reiches. Sie
befinden sich jetzt im Museum Kairo.
Zelt, Bett, Sessel und Armreifen der Hetep-heres I (04-01-16, 17)

Goldgeschirr
der Hetep-heres I (04-01-18)
Tragsessel der Hetep-heres I, Sesselrückwand
(04-01-19, 20)
Zeitzeugen
des Snofru:
Quellen:
von Beckerath, J., Münchner Ägyptologische Studien (MÄS 46 und 49) Mainz 1997/99
Schneider, T., Lexikon der Pharaonen, Düsseldorf 2002
Stadelmann, R., Die Ägyptischen Pyramiden, Mainz 1997
Lehner, M., Das erste Weltwunder, Düsseldorf 1997
Verner, M., Die Pyramiden, Hamburg 1999